
Der Herbst weckt in mir immer leicht melancholische Gefühle. Vielleicht liegt es an den fallenden Blättern und am Frühfrost, vielleicht daran, dass sich Mitte Oktober der Todestag meiner Mutter jährt, aber die Welt um mich herum mahnt mich mehr als sonst an die Vergänglichkeit des Lebens. Ein leiser Schmerz liegt in der kälter werdenen Luft, und ich gerate in eine wehmütige und nachdenkliche Stimmung.
In dieser Stimmung lasse ich das Jahr, lasse ich die Jahre Revue passieren, und am präsentesten sind mir in diesem Augenblick nicht meine Erfolge und schönen Erinnerungen, sondern all die Momente, in denen ich – vor allem an Menschen – versagt habe. In denen ich Fehler gemacht habe, die tiefe Auswirkungen auf Beziehungen und auf das Leben anderer hatten.
In einem Post hat ein befreundeter Blogger die Frage gestellt, ob wir ein Anrecht darauf haben, dass Menschen uns verzeihen. Diese Frage habe ich mir auch schon gestellt, und in der wehmütigen Herbststimmung, angesichts meiner angehäuften Misstritte und dem daraus resultierenden „Fallout“ bewegt sie mich besonders. Das Bewusstsein, Menschen verletzt oder sogar geschadet zu haben, schmerzt, und die Gewissheit, dass mir verziehen wurde, würde diesen Schmerz entscheidend lindern. Dennoch lautet die Antwort, die ich mir selbst auf die Frage gebe, klar und deutlich „Nein“.
Natürlich dürfen wir hoffen, dass unserer Familie oder unseren Freunden im Fall eines Zwists genug an uns liegt, um wieder auf uns zuzugehen. Dass unser Ehepartner uns vergibt, weil wir uns versprochen haben, in guten und schlechten Zeiten zueinander zu stehen. Natürlich dürfen wir als Christen daran glauben, dass das Gebot Jesu, zu verzeihen, Herzen öffnet, die sich aus Wut und Verletzung gegen uns verschlossen haben. Aber einen Anspruch auf Vergebung haben wir nicht.
Wenn uns verziehen wird, ist es immer ein unverdientes Geschenk. Deshalb müssen wir damit leben, dass Menschen uns nicht vergeben können, selbst wenn sie wollen, andere uns nicht vergeben wollen, auch wenn sie könnten, und andere es weder können noch wollen. Wir können das, was wir anderen willentlich oder unwillentlich angetan haben, weder „gut machen“ noch uns ihre Vergebung erarbeiten oder erkämpfen – es liegt nicht in unserer Macht.
Die Erkenntnis, dass ich jemanden genauso wenig zwingen kann, mir zu verzeihen, wie ich ihn zwingen kann, mich zu lieben, hinterlässt in mir eine Leere, eine schmerzende Wunde und die Frage, ob ich denn gar nichts tun kann. Ich habe aus diesen Momenten die Gewissheit gewonnen, dass es doch etwas gibt, was ich tun kann und sogar tun muss, wenn ich die Zuversicht, das Vertrauen in mich selbst und die Energie für das aufbringen soll, was vor mir liegt.
Ich kann vergeben.
Und zwar mir selbst.
Dabei geht es nicht darum, erst sorglos auf anderen herumzutrampeln und dann fröhlich pfeifend davonzugehen. Wenn ich mir bewusst bin, dass ich mich falsch verhalten habe, sollte mich diese Erkenntnis verändern und mir helfen, es künftig besser zu machen. Doch es ist entscheidend, dass ich mir vergebe und die Last ablege. Wenn ich das nicht mache, sondern in schöner Regelmäßigkeit all meine Fehler, Sünden und Missstritte hervorkrame, werde ich zu meinem eigenen größten Feind und Ankläger.
Wenn wir zu der Sorte Mensch gehören, der es schwerfällt, die eigenen Schwächen und Fehler zu akzeptieren und diese Vergebung für uns selbst auszusprechen, dürfen wir eine Wahrheit in Anspruch nehmen, die auf ewig festgeschrieben ist:
Wenn wir Gottes Angebot der Vergebung annehmen, das er uns in Jesus macht, wird Gott uns vergeben. In seinen Augen werden und bleiben wir makellos, und wenn er in unserem Leben Priorität hat, nimmt seine Vergebung uns die Last von den Schultern – auch dann, wenn wir selbst oder andere uns die Vergebung verweigern.
Wir sind frei. Nicht frei von der Verantwortung für die Konsequenzen, die allenfalls aus unseren Fehlern entstanden sind, aber frei von dem, was wir uns zuschulden haben kommen lassen – sei es ein böses Wort, das verletzt, eine Hinterlist, die Menschen entzweit, oder eine tiefgehendere Sünde, die größere Konsequenzen nach sich gezogen hat.
In der Bibel stoße ich zu diesem Thema auf einen vermeintlichen Widerspruch, was die Vergebung bei Gott betrifft. In der Bergpredigt sagt Jesus:
„Wenn ihr den Menschen ihre Verfehlungen vergebt, wird euer Vater im Himmel euch auch vergeben. Wenn ihr aber den Menschen nicht vergebt, wird euer Vater im Himmel euch eure Verfehlungen auch nicht vergeben.“
Wer Traumatisches erlebt hat, das sich nicht so schnell vergeben lässt, könnte diese Worte als niederdrückenden Zwang zur sofortigen Vergebung interpretieren. Ich glaube, dass Gott weiss, wie lange es dauert, schwere Verletzungen zu vergeben, und uns diese Zeit gewährt. Aber ich sehe die Bibelstelle als Ermutigung, das Gebot, zu verzeihen, ernst zu nehmen.
Persönlich will ich wo immer möglich anderen vergeben, wo sie mich verletzt, mir Unrecht getan oder mich hintergangen haben. Damit bereite ich den Boden dafür, dass auch mir vergeben wird. Und ich betreibe Seelenwellness, indem ich mein Herz immer wieder konsequent von Bitterkeit, Rachsucht und anderen negativen Gefühlen reinige und nicht zulasse, dass solche Gefühle Wurzeln schlagen.
Dies alles macht mir aufs Neue bewusst, dass wir Menschen schwache Gefäße sind – fähig zu allem möglichen Bösen, oft inkonsequent, feig und träge. Wenn ich mir vor Augen führe, wie schnell wir einander wehtun können, scheinen menschliche Beziehungen unglaublich zerbrechlich. Dennoch will ich mir immer wieder das Wunder vor Augen führen, dass wir einander auch tief verstehen können und dass es unter uns Liebe, Gemeinschaft, Unterstützung und auch immer wieder Vergebung gibt.
Menschliche Gemeinschaft wird uns nicht einfach geschenkt. Sie ist riskant, schmerzhaft, herausfordernd. Dass wir in ihr und an ihr immer wieder scheitern, scheint unausweichlich. Und doch ist sie es wert, sein Herz immer wieder zu Markte zu tragen, es zu öffnen und Begegnung zuzulassen. Ich will weder an meinen Fehlern noch an denen der anderen zerbrechen und mich erinnern, dass Beziehungen das sind, was unserem Gott am allerwichtigsten ist. Für unsere Beziehung zu ihm hat er uns seinen Sohn geschickt, und uns Menschen hat er so erschaffen, dass wir einander brauchen und aneinander wachsen.
Und wenn mir das Herz ob meiner Schwächen und der anderer Menschen brechen will, wenn ich verzagen und mich verkriechen will, um keinen Schaden anzurichten und nicht verletzt zu werden, lege ich mir die Worte von C.S. Lewis auf die Brust:
„Lieben heißt verletzlich sein. Liebe irgend etwas, und es wird dir bestimmt zu Herzen gehen oder gar das Herz brechen. Wenn du ganz sicher sein willst, dass deinem Herzen nichts zustößt, dann darfst du es nie verschenken, nicht einmal an ein Tier. Umgib es sorgfältig mit Hobbies und kleinen Genüssen; meide alle Verwicklungen; verschließ es sicher im Schrein oder Sarg deiner Selbstsucht. Aber in diesem Schrein – sicher, dunkel, reglos, luftlos – verändert es sich. es bricht nicht; es wird unzerbrechlich, undurchdringlich, unerlösbar. Die Alternative zum Leiden, oder wenigstens zum Wagnis des Leidens, ist die Verdammung. Es gibt nur einen Ort außer dem Himmel, wo wir vor allen Gefahren und Wirrungen der Liebe vollkommen sicher sind: die Hölle.“









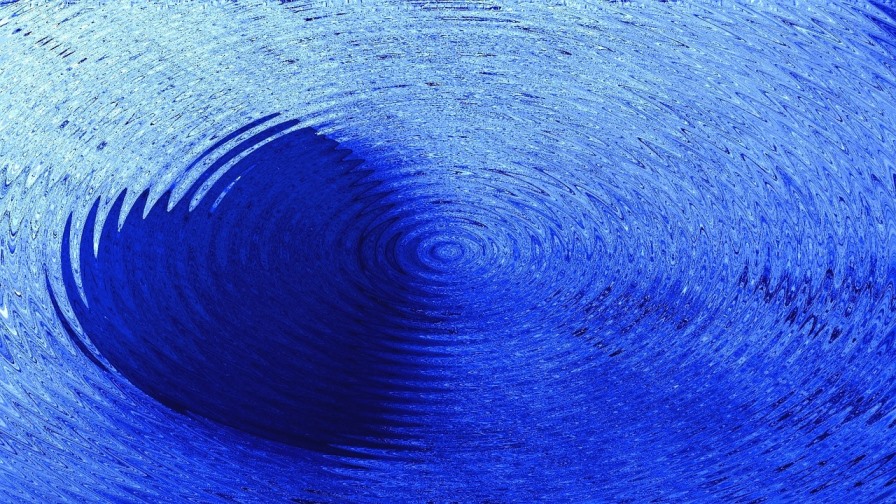










Letzte Kommentare